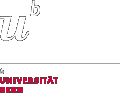Scheurer, Janine (2022). «VnEydgnossische Gewalthätigkeiten»: Mehrschichtige Identitäten und Coping-Strategien im Kontext des 1. Villmergerkrieges von 1656. (Thesis). Universität Bern, Bern
|
Text
22scheurer_j.pdf - Thesis Available under License Creative Commons: Attribution-Noncommercial-Share Alike (CC-BY-NC-SA 4.0). Download (8MB) | Preview |
Abstract
Die Dissertation untersucht die Mechanismen der Konfliktbewältigung in der frühneuzeitlichen Eidgenossenschaft unter besonderer Berücksichtigung der konfessionellen Spannungen, die zum 1. Villmergerkrieg von 1656 führten. Die Arbeit fokussiert auf die Frage, wie trotz tiefgreifender konfessioneller Differenzen und gewaltsamer Auseinandersetzungen ein vergleichsweise friedliches Zusammenleben bewerkstelligt und das Fortbestehen des Corpus helveticum gesichert werden konnte. Da die bisherige Forschung vor allem die Ereignisgeschichte untersucht hat, schliesst die Dissertation vorhandene Forschungslücken, aus der sich obige Fragestellungen ergeben. Ausgangspunkt der Analyse ist der 2. Kappeler Landfrieden von 1531, der das bikonfessionelle Zusammenleben in der Eidgenossenschaft institutionalisierte. Die evangelischen Orte blieben aufgrund ihrer geringen Anzahl und der damit einhergehenden Stimmrechte strukturell benachteiligt, weshalb die Konflikte nicht gelöst, sondern lediglich politisch eingefroren wurden. Die ungelösten Spannungen bildeten den Nährboden für neue Konflikte. Zur Untersuchung dieses komplexen Prozesses entwickelt die Dissertation ein kombiniertes Konzept aus Identität und Alterität, Rhetorik sowie Coping-Strategien. Identität wird als ein mehrgliedriges und mehrschichtiges Selbstkonzept verstanden, das situations- und kontextabhängig ist und sich parallel zur Konstruktion der Alterität, der Abgrenzung vom «Anderen», vollzieht. Die konfessionelle Identität stellt dabei nur eine von vielen Teilidentitäten dar. Rhetorik wird als zielgerichtete, symbolische Kommunikation definiert, die bestimmte Bilder des Selbst und des Anderen entwirft. Die Arbeit analysiert, wie mittels Rhetorik konfessionelle Identitäten hervorgehoben und über andere Teilidentitäten gestellt oder aber bewusst in den Hintergrund gedrängt wurden. Das Konzept des Coping dient der Analyse des Umgangs mit dem fundamentalen Stressor der konfessionellen Spaltung. Da die Ursachen der religiösen Konflikte (die Existenz der anderen Konfession) nicht zu lösen waren, geht es beim Coping darum, die Konflikte anzunehmen, zu formen und aushaltbar zu machen, nicht sie zu befrieden. Die Analyse des 1. Villmergerkrieges zeigt, wie die Fronten zwar entlang der Konfessionsgrenzen verliefen, religiöse Kriegsmotive jedoch nicht mehr als legitim galten. Zürich versuchte sein Vorgehen nicht theologisch, sondern rechtlich zu begründen. Besonders beleuchtet wird die Rhetorik in publizistischen Medien wie Flugschriften und Flugblättern, die massgeblich zur öffentlichen Meinungsbildung beitrugen. Im Gegensatz zu den radikaleren Stereotypen des Dreissigjährigen Krieges wurden die Feindbilder im eidgenössischen Kontext weniger absolut formuliert. Der jeweilige Gegner wurde als Miteidgenosse angesehen, der sich durch sein fehlgeleitetes Verhalten selbst ausgeschlossen hatte und durch Verhaltensänderung zurückgewonnen werden sollte. Flugschriften wie die «Thurgauer Gespräche» riefen zur friedlichen Beilegung auf und betonten den gemeineidgenössischen Frieden, der eng mit der eidgenössischen Befreiungstradition verknüpft war. Die Verwendung von ausdrucksstarken Metaphern erleichterte den humoristischen Umgang mit den Gewalterfahrungen sowie deren Bewältigung. Als wesentliche Coping-Strategien der Eidgenossenschaft erwiesen sich die institutionalisierte Kommunikation auf der Tagsatzung sowie das bewusste Ausklammern theologischer Grundsatzfragen. Die regelmässigen Treffen, oft erzwungen durch die Konflikte in den Gemeinen Herrschaften, verhinderten den vollständigen Kommunikationsabbruch. Das Fortbestehen der Eidgenossenschaft war nicht einem ursprünglichen Friedenswillen, sondern der Fähigkeit der beteiligten Akteure zu verdanken, durch gemeinsame Konfliktbearbeitung und die Entwicklung von Coping-Strategien zu einem Auskommen zu finden.
| Item Type: | Thesis |
|---|---|
| Dissertation Type: | Single |
| Date of Defense: | 13 October 2022 |
| Subjects: | 900 History > 940 History of Europe |
| Institute / Center: | 06 Faculty of Humanities > Department of History and Archaeology > Institute of History |
| Depositing User: | Hammer Igor |
| Date Deposited: | 02 Oct 2025 10:26 |
| Last Modified: | 02 Oct 2025 22:25 |
| URI: | https://boristheses.unibe.ch/id/eprint/6763 |
Actions (login required)
 |
View Item |